Der Sprung in die Wirklichkeit Einfach machen. In Blomberg ist ein Fabrikgebäude entstanden, in dem dank eines ausgeklügelten Gleichstromnetzes energieeffizienter und nachhaltiger produziert werden kann. Ein Blick hinter die Kulissen verrät, wie Gleichstrom in der Praxis funktioniert.


2.760 Solarpanels auf 11.000 m² Dachfläche
Die All Electric Society Factory
Ein sonniger Nachmittag in Blomberg. Wie ein gläsernes Meer wellen sich auf den 11.000 m² Dachfläche lange Reihen von Solarpaneelen. Sobald Sonnenlicht auf das Halbleitermaterial trifft, fließt Strom. Bis auf die Größe der Anlage ein ganz normaler Anblick auf vielen deutschen Dächern.
Doch dieses Gebäude ist anders: Wo andernorts Wechselrichter dafür sorgen, dass der Gleichstrom aus der Solaranlage zu Wechselstrom umgewandelt wird, fließt er hier direkt in ein lokales Gleichstromnetz. „Ein Gleichstromnetz optimiert die gesamte Energiekette aus Erzeugung, Verteilung, Speicherung und Verbrauch“, erklärt Tobias Lüke, Experte für Gleichstromnetze bei Phoenix Contact.
Der Experte beginnt seine Führung durch das Gebäude gern auf dem Dach. Hier, am Solarfeld, wird deutlich, warum Gleichstrom überall auf dem Vormarsch ist: „Nicht nur die Erzeuger arbeiten auf Gleichstrombasis, sondern auch Energiespeicher oder Verbraucher. Die meisten elektrischen Geräte und Produktionseinheiten arbeiten mit Gleichstrom.“

DC-Ladesäulen vor der All Electric Society Factory
Lasten die Spitzen nehmen
Zehn Ladepunkte sind auch vor der All Electric Society Factory zu finden. Sie sind wichtige Akteure im Gleichstromkosmos. Daher führt Tobias Lüke hinab auf den Parkplatz, wo sich die Energiespender aufreihen. „Über bidirektionale DC-Ladesäulen (DC = Gleichstrom) könnten Firmenwagen in Zukunft nicht nur ihre Antriebsbatterien aufladen, sondern aus diesen auch Energie direkt und ohne erneute Wandlung ins System zurückspeisen“, erklärt Lüke.
Beim Blick in eine der Ladesäulen zeigt sich, dass Phoenix Contact für das Thema Gleichstrom gut aufgestellt ist. „Überspannungs- und Geräteschutz, DC-Leistungsschalter und DC-Ladestecker – die Energieflüsse werden durch unsere Leistungsmodule optimal ausgesteuert.“
Die Fahrzeugbatterien sind aber längst nicht alles: Tobias Lüke zeigt auf einen unscheinbaren, weißen Container: „Eine stabile Energieversorgung auf Basis von erneuerbarer Energie braucht hinreichend große und zuverlässige Speicher, um Schwankungen auszugleichen“, erklärt der Gleichstromexperte.
„Und wir können mit diesen Speichern Lastspitzen gegenüber dem öffentlichen Versorgungsnetz ausgleichen.“ Lastspitzen entstehen, wenn etwa große Elektromotoren in Produktionsmaschinen anlaufen. Sie verbrauchen dann kurzzeitig mehr Strom als mit dem Versorger vereinbart. Und das lässt der sich teuer bezahlen. „Wir konnten mit dem Abpuffern der Lastspitzen durch unsere Batterien die Stromkosten um bis zu 80 % reduzieren.“

Schaltschränke für das Gleichstromnetz
Denken, lenken und steuern
Tobias Lüke führt uns in die technischen Katakomben des Gebäudes, hinab in den Keller, wo das zentrale Nervensystem der Gleichstromversorgung sitzt. Schaltschrank reiht sich an Schaltschrank. Sie binden nicht nur Photovoltaikanlage, Batteriespeicher und Ladesäulen ins System ein. Hier wird auch der Strom aus dem öffentlichen Netz eingespeist oder Überschüsse zurückgegeben.
„Unsere Leistungsmodule können bidirektional – also in beide Richtungen – betrieben werden“, führt Lüke aus und öffnet einen Schaltschrank, in dem sich die Module schubladenartig aufreihen. „Durch den modularen Aufbau lassen sich die Schaltschränke flexibel bestücken und die Leistung je nach Bedarf einfach skalieren.“

DC-Schaltschrank in der All Electric Society Factory
Kupfergeiz und Stromersparnis
Ein Dreh, dann ist der Schaltschrank offen. Viel Rot und Weiß in trauter Zweisamkeit – Plus und Minus im Gleichstromnetz. Was ebenfalls sofort auffällt: Leitungen und andere Komponenten sind deutlich kleiner als bei herkömmlichen Verteilungen – ein weiterer Vorteil dieser Technologie: „Gleichstromnetze benötigen weniger Kupfer für die Stromübertragung. Bis zu 55 % dieses teuren Rohstoffs lassen sich so einsparen“, so Lüke. Hier in der Schaltzentrale landen auch die weißen und roten Strings aus der PV-Anlage. Über DC/DC-Wandler mit einer Gesamtleistung von 120 kW speisen sie auf den sogenannten DC-Bus.
Von der Niederspannungshauptverteilung wird der Gleichstrom auf den Produktionsbereich verteilt. Hier arbeitet die Beleuchtung direkt mit der Energie aus dem DC-Netz. Zwei Abzweige führen zum Anschluss an die Produktionsmaschinen. „Im Gleichstromnetz können wir die Bremsenergie von Robotern und Antrieben nutzen und direkt ins System zurückgeben“, erläutert Lüke den nächsten wichtigen Vorteil des Gleichstroms. „Allein über diese Rekuperation lässt sich je nach Anwendung eine Effizienzsteigerung um bis zu 20 % erreichen.“
Ist trotz aller Verbraucher und Speicher noch überschüssige Energie im Gleichstromnetz vorhanden, speisen die bidirektionalen AC/DC-Wandler netzkonform ins öffentliche Wechselstromnetz zurück.

Leistungsschalter CONTRACTON ELR HDC
Es wird handfest
Überall dort, wo DC-Lasten in der All Electric Society Factory sicher geschaltet werden müssen, wird der Leistungsschalter ELR HDC eingesetzt. Er kombiniert die Funktionen Schützen, Schalten, Überwachen, Vorladen und Netzwerkfähigkeit. Spezielle DC-Energiezähler erfassen die Energieströme. Und um DC-Anschlüsse zu verbinden, wird der ArcZero-Gleichstromsteckverbinder eingesetzt. Er ermöglicht das lichtbogenfreie Stecken und Ziehen unter Last.
Das Lastmanagement und das übergeordnete DC-Netzmanagement erledigt die Software-Plattform PLCnext Engineer. Sie vereint die einzelnen Bereiche zu einem ganzheitlichen System. Die Steuerung integriert zudem Daten wie Stromkosten an den Strombörsen, Wettervorhersagen sowie tagesaktuelle Daten von der Messstation auf dem Dach in das Gebäudeenergiemanagement.

Tobias Lüke, Experte für Gleichstromnetze
Nicht nur reden
Die All Electric Society Factory in Blomberg besitzt in der Branche bereits einen Ruf weit über die Landesgrenzen hinaus. Nicht nur reden, sondern auch umsetzen – Gleichstrom funktioniert schon hier und heute, wie die auf Gleichstrom konzipierte Fertigung mit ihrer Energiebilanz jeden Tag zeigt.
Aber „diese Anlage ist ausdrücklich auch für Versuchszwecke und Betriebstests konzipiert“, ergänzt Tobias Lüke. Insgesamt erhoffen sich die Macher dieses Pilotprojekts noch weitere Einsparungen und Effizienzsteigerungen. Geplant ist u. a. der Aufbau einer Windkraft-Kleinanlage, ein Elektrolyseur für die Wasserstofferzeugung und Brennstoffzellen, die wiederum Strom aus dem eingelagerten Wasserstoff erzeugen.
Phoenix Contact engagiert sich schon lange für Erforschung und Etablierung der Gleichstromtechnik und ist Gründungsmitglied der Open Direct Current Alliance (ODCA). Als die Planung des Gebäudes begann, gab es auf dem Markt kaum Komponenten und Standards für den Einsatz von DC-Technologie. Heute ist das anders, betont Tobias Lüke: „Mit den verfügbaren Komponenten, regulatorischen Fortschritten, zunehmender Expertise und Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern lohnt es sich auch für andere Unternehmen, den Schritt zu wagen.“
Es ist dunkel geworden in Blomberg. Wir sind am Ende der Führung und Tobias Lüke schließt das Tor zu einem der wohl innovativsten Fabrikgebäude Europas.

Fazit
Gleichstrom umgibt uns längst in jedem Winkel unseres Alltags. Doch in der ganzheitlichen Betrachtung dieser Energie steckt ein wahrer Schatz an Einsparpotenzial. Die All Electric Society Factory ist angetreten, diesen Schatz zu heben. Und dies nicht nur einmalig, sondern als Blaupause für viele andere Industrie- und Fertigungsgebäude.
Die Einführung von Gleichstromsystemen in der Produktionslogistik und Industrie birgt großes Potenzial für Energieeinsparungen, insbesondere für dynamische Lasten wie z. B. in der Produktion eingesetzte Roboter: Die Spitzenleistung kann um bis zu 85 %, die Energieeffizienz um bis zu 20 % erhöht werden.
Konsequent umgesetzt verliert das Schreckgespenst des teuren Industriestroms schnell seinen Schrecken. Das Gebäude als Energiequelle und -speicher – und das heute, mit bestehender Technologie und im harten Produktionsumfeld.
Verbinden Sie sich mit unseren Expertinnen und Experten

Weitere Beiträge

Die Gleichstromrenaissance
Podcast-Folge 2 – Ob Photovoltaikanlage auf dem heimischen Dach oder DC-Stromnetz in der Industrie – die Vorteile von Gleichstrom werden wiederentdeckt.

Gleichstrom mit Leidenschaft
Lokale Gleichstromnetze können bis zu 20 Prozent Energie einsparen, machen den erzeugten Strom direkt speicherbar und senken die nötige Menge an Ressource für ihre Errichtung.
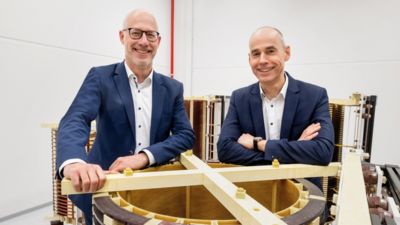
Gleichstromnetze für die Sektorenkopplung
Elektromobilität, Solaranlagen und Batteriespeicher revolutionieren die Industrie.




